- Details
Burgruine Lützelhardt im Schwarzwald
Die Gebietsbezeichnung im Schwarzwald ist wichtig, da es eine gleichnamige Burg im benachbarten Elsass gibt. Burg Lützelhardt (frz. Château de Lutzelhardt) ist eine mittelalterliche Burgruine westlich von Obersteinbach im Elsass.
Bei der Burgruine Lützelhardt im Schwarzwald handelt es sich um die Ruine einer mittelalterlichen Burganlage die im Ortenaukreis in Baden-Württemberg liegt. Die Burg ist das älteste Seelbacher Baudenkmal.
Burgruine Lützelhardt ist auf einem Bergsporn über dem Seelbachtal östlich von Seelbach zu finden. Die einstige Felsenburg liegt auf ca. 460 Meter üNN, Aufgrund ihrer exponierten Lage konnte von der ehemals stark befestigten Burganlage die Passstraße über den Schönberg ins Kinzigtal und ins obere Schuttertal überwacht werden. Vermutlich diente die Burg als Eckpfeiler des Burgendreiecks Ortenberg – Lahr - Lützelhardt, zur Absicherung der Verbindung vom Kinzigtal nach Villingen zum Bodenseeraum und der östlichen Rheinstraße.
Erbaut wurde die aus drei miteinander verbundenen Burgen bestehende Burg Lützelhardt wahrscheinlich durch die gleichnamige Familie aus dem Geschlecht der Zähringer um das Jahr 1200. Die einstige Ritterburg zeigt Übergangsformen vom Romanischen zum Frühgotischen.
Drei Burgen bilden die Burg Lützelhardt
Die drei gesondert stehenden Burgteile der Burg Lützelhardt liegen auf drei unterschiedlich bis zu 10 Meter hohen Felsen, die waren einst vermutlich durch eine Palisade verbunden. Schon im Jahr 1235 wurde Burg Lützelhardt durch den Grafen Walther von Geroldseck aufgrund einer Fehde zerstört, die Reste haben die Jahrhunderte aber recht gut überstanden oder wurden teilweise restauriert oder rekonstruiert.
Die Restaurierung und Pflege der Burgruine
So wurden die Fundamente der einst über 100 Metern langen Burgruine in den Jahren 1926 bis 1929 von Karl Hammel ausgegraben. In den Jahren 1971 bis 1973 sowie von 2008 bis 2010 fanden auf der Burgruine Lützelhardt umfangreiche Sanierungen statt. Wie so oft im Schwarzwald ist es der Schwarzwaldverein der sich im weiteren Verlauf um die Kulturgüter im Schwarzwald annimmt. Seit 1990 erfolgt die Instandhaltung und Pflege der Burg durch die Ortsgruppe Seelbach.
Die Nordwestburg oder Vorderburg
Von diesem ehemaligen Teil der Burganlage sind nur noch Fundamentteile von Hof und Palas zu erahnen. Die verborgenen Fundamente wurden von Archäologen schon mal freigelegt, nach einer Untersuchung aber wieder zum Zwecke der Konservierung wieder mit Erde bedeckt worden. Aufschluss über die einstige Größe dieses Burgteils gibt uns eine Informationstafel.
Die Mittelburg
Auch von ihr existieren nur noch zu erahnende Grundmauern. Die größtenteils aus Holz gefertigte Burganlage der Burg Lützelhardt besaß nicht die Größe der Nordwest- und Südostburg, sie hatte auch keinen Bergfried. Auch hier gibt uns eine Tafel auf einem großen Stein Invormationen zum Burgteil.
Die Südostburg, auch Hauptburg
Sie war die größte, höchst gelegene und exponierteste der drei Burgen die einst die Burganlage der Burg Lützelhardt bildete. Die ursprünglichen Häuser, der Burghof und der Bergfried lassen sich noch heute gut erkennen. Mauerreste sowie Fenster, Fensterverzierungen und Stufen, die im Stil der romanischen Zeit gehalten sind, wurden teilweise restauriert oder rekonstruiert. Reste des Bergfrieds sind noch zu erkennen, auch befindet sich noch eine mittelalterlichen Zisterne. An der Nordseite der Burg kann man unterhalb des Burgfelsens noch einen flankierten Zwinger nebst Zugang erkennen.
Blick zur Geroldseck
Wer von der Burgruine Lützelhardt nach Nordosten schaut hat einen hervorragenden Blick zur gegenüberliegenden Burg Hohengeroldseck.
Anfahrt
Über die A5 Ausfahrt “Lahr“ auf die B415. Hinter Reichenbach von der Bundesstraße nach Seelbach abbiegen. Dann am besten am Friedhof parken. Die abgelegene Burgruine Lützelhardt ist nur zu Fuß oder Rad erreichbar. An den Wegen, die überwiegend aufwärts gehen sind Schilder mit einem gelben Rautensymbol versehen sind, zeigen den etwa 30 Minuten dauernden (Fuß) Weg zur Burg. Die Burganlage ist frei zugänglich / immer geöffnet.
- Details
Hohengeroldseck
Die Burg Hohengeroldseck in Seelbach, besser als Burgruine Hohengeroldseck bekannt (nicht zu verwechseln mit einer gleichnamiger Burg im Elsass) ist sicher eine der beeindruckendsten Burgen im Schwarzwald. Zu finden ist die Burgruine, die einst Sitz der Herren von Geroldseck war in der Ortenau, auf einer Anhöhe zwischen dem Kinzigtal und dem Schuttertal.
Schon von weitem sind die Mauern der Ruine Hohengeroldseck mit den gut erhaltenen Außenmauern des Wohnhaus, dem Wohngebäude (Palas) zu sehen. Die Burg und das vierstöckige Wohngebäude (Oberburg), das einst Wohnräume und einen 80 Quadratmeter großen Rittersaal der Geroldsecker beherbergte, wurde in den Jahren 1240 bis 1250 von Walther I. von Geroldseck für das Rittergeschlecht der Geroldsecker als Stammburg erbaut.
Die Burg die übrigens keinen Turm (Bergfried) hat, besitzt eine Ausdehnung von ca. 95 auf 50 Metern. Erhalten sind neben dem schon erwähnten Mauern des Wohngebäude die ca. 10 Meter hohen und 2,10 Meter dicken Außenmauern der Unterburg.
Durch einen gotischen Spitzbogen geht es in den Palas, dessen hoch aufragenden Außenwände mit zahlreichen Fenster im größtenteils romanischen Stil mit die Faszination der Burgruine Hohengeroldseck ausmachen.
Die Treppenspindel des alten Palas führt bis ins oberste Stockwerk dessen Mauerreste sich auch betreten lassen, was eine wunderbare Ausschau zulässt. Erwähnenswert der Blick auf der Treppenspindel in den Palas-"Kerker".
Der Erbauer der Burg
Die Ritterburg im Schwarzwald wurde von Walther I. von Geroldseck erbaut. Als Spross der begüterten Familie der Herren von Geroldseck war sein Weg nach oben fast vorbestimmt. Walther wurde 1247 Domherr und 1252 Dompropst in Straßburg. Im Jahr 1260 sogar Bischof von Straßburg. Die Amtszeit des Walther I. von Geroldseck war geprägt vom Kampf gegen die Autonomiebestrebungen der Straßburger Bürgerschaft. Unterstützt von benachbarten Adelsgeschlechtern fällt ihm ausgerechnet der spätere König Rudolf von Habsburg in den Rücken, am 8. März 1262 erleiden Walters Truppen in der Schlacht von Hausbergen eine entscheidende Niederlage. Im Jahr 1277 stirbt Walther I. von Geroldseck und die Burg wird aufgeteilt zwischen seinen Brüdern Georg und Heinrich.
Die Zerstörung der Burg Hohengeroldseck
Wie bei vielen anderen Burgen im Schwarzwald ist es eine Geschichte in mehreren Akten, dreimal wird die Burg erfolglos belagert, erst durch die Franzosen im dreißigjährigen Krieg 1689 wird die Burg zerstört, die Burg brennt vollständig aus.
Die Burgruine vor dem weiteren Verfall bewahren
Auch wenn Hohengeroldseck zu den wenigen öffentlich zugänglichen Burgen gehört die noch in Privatbesitz sind, 1819 kommt die Burgruine an das Großherzogtum Baden, die Fürsten von der Leyen sind bis heute Eigentümer der Burganlage. Eine Fortbestand und Erhalt der Burg ist mit privaten Mitteln nicht möglich, so gibt es bereits 1892-1901 erste Versuche der Restaurierung durch den Lahrer Schwarzwaldverein
In den Jahren 1951-1952 baut der Lahrer Schwarzwaldverein eine neue Wendeltreppe in den Turm des hinteren Palas ein.
Im Jahr 1958 gründet der damalige Landrat des Landreises Lahr, Dr. Wimmer einen Verein, den Burgverein, um die Burgruine vor dem weiteren Verfall zu retten. Mitglieder sind neben interessierten Bürgern auch die umliegenden Gemeinden, wie Seelbach, Schuttertal, Biberach und Lahr. Für einen Mindestbeitrag von 12 Euro können auch Sie Mitglied werden und somit dazu beitragen, dass die Burgruine Hohengeroldseck erhalten bleibt.
Öffnungszeiten
Die Burg Hohengeroldseck in Seelbach ist ganzjährig geöffnet, es ist nicht möglich mit dem PKW bis an die Burg zu fahren.
Wanderwege um die Ruine Hohengeroldseck
Der Burgpfad
Der ca. 2 km lange Geroldsecker Burgpfad gibt mit insgesamt 9 Stationen am Wegrand, Fragen rund Antworten zum Leben auf einer Burg. Was besonders Kindern die Lust am Wandern erhöhen soll.
Geroldsecker Qualitätsweg
Der 35,5 km lange Geroldsecker Qualitätsweg lässt sich in die Etappen Nord und Süd aufteilen. Ein Erlebnis bietet der überwältigende Rundblick auf der Burg Hohengeroldseck.
- Details
 Burgruine Alt-Eberstein Google Maps
Burgruine Alt-Eberstein Google Maps
Die Burgruine Alt-Eberstein in Baden-Württemberg liegt im Baden-Badener Stadtteil Ebersteinburg auf einer Bergkuppe 426 Meter üNN. Schon von der A5 und der Rheintalbahn ist die Burg hoch über Baden-Baden zu sehen. Der mächtige Bergfried und die Mauern der mittelalterlichen Ritterburg scheinen direkt aus dem Felsen herauszuwachsen.
Bei den Menschen der Gegend ist sie besser als Burg oder Ruine Ebersteinburg bekannt. Die Burg war Stammsitz der Grafen von Eberstein, die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts auf das in der Nähe befindliche neue Schloss Eberstein wechselten.
Der Zeitpunk der Errichtung Burg Alt-Eberstein ist nicht genau bekannt, sie wurde erstmals 1197 als "Castum Eberstein" erwähnt, mit dem Vorsatz "Alt" wurde die Burg erstmals 1283 benannt. Erbauer der Burg sind die Grafen von Eberstein in Schwaben, deren Stammsitz sie auch wurde. Von der Burg gibt es einen grandiosen Ausblick auf Baden-Baden, ins Rheintal, Richtung Kraichgau, Murgtal und Bad Herrenalb sowie auf die Höhen des Nordschwarzwalds und gegenüber auf die Vogesen.
Mit zur Burganlage gehört eine Gaststätte mit Biergarten, für Gäste gibt es eine Drei-Zimmer-Ferienwohnung, eine große Terrasse mit Ausblick lädt zum Verweilen und Kaffee trinken ein.
Die Burganlage und die Burg kann besichtigt werden, der begehbare Bergfried besitzt eine Plattform mit herrlicher Rundum-Aussicht. Burg Alt-Eberstein ist für Erwachsene und Kinder ein großes Erlebnis. Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
14 - 22 Uhr, Sonn- und Feiertags ab 12 Uhr,
Montag und Dienstag Ruhetag
Anfahrt:
Um zu Alt-Eberstein zu gelangen kann man mit der Buslinie 214 der BBL bis zur Haltestelle „Michaelskapelle“ fahren. Von dort aus sind es noch etwa 10 Fußminuten. Wanderer können die Ruine Alt-Eberstein auf dem insgesamt ca. 10 km langen Ebersteinburg-Rundweg erreichen, der direkt an der Burgruine vorbeiführt.
Parkplätze:
Auch mit dem Auto ist die Burg gut zu erreichen, entweder die Parkplätze an der Wolfschlucht benutzen, oder in der Nähe der Burg sind kostenlose Parkplätze vorhanden.
Wanderwege
Ebersteinburg-Rundweg, Start am Wanderportal Wolfschlucht, mit einer Länge von ca. 10 km, ca. 3,5 Stunden Gehzeit,
Murgleiter Etappe 1, Start am Unimog-Museum Gaggenau-Bad Rotenfels, Ziel Gernsbach Murgleiter-Portal mit einer Länge von ca. 23, 7 km, ca. 8 Stunden Gehzeit Die Architektur
Die Architektur
Die Burg ist auf einem nach Nordwesten steil abfallenden Felsen aus Porphyr erbaut, bis zu 30 Meter tief fallen die Felswände seitlich ab, so war die Burg von diese Seite praktisch uneinnehmbar. Sie besteht aus Haupt- und Vorburg, in die Burg geht es durch das untere Burgtor zuerst in die Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden (nicht erhalten, heute Parkplatz) über eine Treppe erreicht man die Kernburg mit dem 20 x 20 Meter großem inneren Burghof. Von der Burg erhalten ist leider nur der quadratische Bergfried (Wehrturm) mit einer Höhe von 18 Metern und einer Seitenlänge von etwa 8 Metern, Aufgrund seiner Bauweise kann geschlossen werden, dass er ursprünglich sogar höher und mit Zinnen versehen war. Im Inneren ist (heute) eine Treppe angebracht, so das der Bergfried mit der Plattform betreten werden kann, früher wurde der Turm durch ein in großer Höhe gelegenes Rundbogenportal betreten.
Erhalten ist auch die mächtige Schildmauer aus Buntsandstein, die bis zu einer Höhe von 14 Metern aufragt und Mauerreste und Fensternischen des nicht für Besucher zugänglichen Palas (Wohngebäude/Rittersaal). Gewaltige Steinblöcke von bis zu 2 Metern Breite und 1 Meter Dicke tragen das Gewicht der Mauern. Die Burganlage besitzt einen Burghof an dessen nördlichem und östlichem Ende Wohngebäude standen, auch ein Brunnen stand im Burghof. Auf den Gebäuden der östlichen Seite steht heute die Burggaststätte, sie wurde in der ersten Hälfte des 19 Jahrhundert erbaut um den gerade aufkommenden Touristen gerecht zu werden.
Die Geschichte der Burg Alt-Eberstein
Die Schildmauer der Burg ist der älteste Teil der Burg, sie wurde wahrscheinlich um 1100 erbaut. Der Bergfried, die Vorburg und die Wohngebäude sowie Teile der Schildmauer sind späteren Datums, wohl aus dem 13. Jahrhundert. Durch Hochzeit von Kunigunde von Eberstein mit dem Markgrafen Rudolf I. von Baden im Jahr 1240 kommt die Burg zur Hälfte als Mitgift in den Besitz der Markgrafen, 1283 wurde auch die andere Hälfte an den Markgrafen verkauft. Das zeigt sich auch an umfangreichen Umbaumaßnahmen, die eindeutig Ähnlichkeit mit den Bauten des Markgrafen zeigen. Zeitweise wurde die Burg Alt-Eberstein sogar als Residenz genutzt, jedoch bald an Burgmannen vergeben. Schon im Jahr 1290 wird ein Johann von Berwartstein als Burgmann genannt. Um 1400 wird die Burg als Archiv und Schatzkammer der Markgrafen verwendet, schriftliche Unterlagen waren damals einziger Beweis zahlreicher Rechtsansprüche.
Zeitweise wurde die Burg Alt-Eberstein sogar als Residenz genutzt, jedoch bald an Burgmannen vergeben. Schon im Jahr 1290 wird ein Johann von Berwartstein als Burgmann genannt. Um 1400 wird die Burg als Archiv und Schatzkammer der Markgrafen verwendet, schriftliche Unterlagen waren damals einziger Beweis zahlreicher Rechtsansprüche.
1434 ließ Markgraf Jakob I. seine Schwester Agnes von Baden, die unehelich gezeugte Kinder gebar, auf der Burg internieren. Nach ihrem Tod im Jahr 1473 erhielt der badische Haushofmeister Hans von Bergen die Burg als Ruhesitz, der Markgraf gab ihm die Burg aufgrund seiner Verdienste. Seit etwa 1573 wurde Alt-Eberstein nicht mehr bewohnt, die Güter der Burg wurden an die Gemeinde verliehen. Danach erlebte die Burg das gleiche Schicksal anderer mittelalterlicher Gebäude, die wertvollen Steine wurden als Baumaterial für andere Gebäude verwendet. Erst aus einem Gutachten von 1800 sind Unterlagen die der Erhaltung der Burgruine Ebersteinburg bekannt.
Die Geschichte der Grafen von Eberstein
Das einst wohlhabende, mächtige und einflussreiche Adelsgeschlecht währte nur über eine relativ kurze Zeit, zumindest was Einfluss und Macht betraf. Ihre Burg und Ländereinen lag in unmittelbarer Nachbarschaft der Markgrafen von Baden, was auch den Untergang der Grafenfamilie beschleunigte. So kam es durch Erbteilungen und politischen Zufällen bald zum schwinden der Macht und Besitz. Die Markgrafen von Baden und die Grafen von Württemberg, gegen die später eine Fehde geführt wurde, sollten sich letztlich als zu mächtig erweisen.
Der erste Graf der den Name Eberstein trägt ist Bertold I, auf einer Schenkungsurkunde des Klosters Reichenbach aus dem Jahr 1085 wird vermerkt, dass "Berthold de Eberstein" zum Bau einer Burg Land übertragen wird, die dem Schutz der Ländereien Klosters Reichenbach dienen soll. Die Herren von Eberstein verlegen ihren Wohnsitz somit aus der Rheinebene auf die Höhenburg. Um 1149 stiftet Graf Berthold III. das Kloster Herrenalb aus Dankbarkeit dafür, dass er vom 2. Kreuzzug in die Heimat zurückkehren durfte. Das Hauskloster der Ebersteiner übergab er den Zisterzinsern. Später gründete er auch noch das Kloster Frauenalb. Bald darauf spalten sich die Ebersteinburger in zwei Familien auf.
Um 1149 stiftet Graf Berthold III. das Kloster Herrenalb aus Dankbarkeit dafür, dass er vom 2. Kreuzzug in die Heimat zurückkehren durfte. Das Hauskloster der Ebersteiner übergab er den Zisterzinsern. Später gründete er auch noch das Kloster Frauenalb. Bald darauf spalten sich die Ebersteinburger in zwei Familien auf.
In der Folge werden den Herren von Eberstein die Geldmittel knapp, die Hochzeit von Kunigunde von Eberstein mit Markgrafen Rudolf I. im Jahr 1240 gibt die Hälfte der Burg als Mitgift an den Markgraf von Baden.
Mitte des 13. Jahrhunderts baut und bewohnt Otto I. das Schloss Neu-Eberstein, sein Sohn Otto III verkauft die andere Hälfte von Burg Alt-Eberstein an den Markgrafen von Baden für 375 Mark lötigem Silber. Im Jahr 1288 kommt auch das Dorf Ebersteinburg an die Badener Markgrafenfamilie.
Die Familie zieht in das bei Gernsbach gelegene Schloß Neu-Eberstein, eine Fehde mit den Grafen von Württemberg führte zu einem 15 Jahre dauernden Krieg, der die Grafen von Eberstein letztlich in den finanziellen Ruin führt.
Total verschuldet verkauft Graf Wolf von Eberstein alle seine Güter an Markgraf Rudlf VII., er stirbt später völlig verarmt.
Um 1556 kommt es mehrfach zu Streitigkeiten um die Religion, Graf Wilhelm IV. von Eberstein führt die Reformation ein. Eine Linie der Familie bleibt jedoch katholisch.
Im Jahr 1580 ist es soweit, die ältere Linie der Ebersteiner hat keine männlichen Nachkommen mehr. Und im Jahr 1660 stirbt auch der andere Zweig der Grafen-Familie im Mannesstamm aus.
Informationen zum Urheberecht
Die in diesem Artikel eingestellten Bilder dürfen unverändert und unter Angabe der Quelle kopiert und zum Zweck der öffentlichen Berichterstattung in allen Medien weiterverarbeitet werden.
Für eine größere Version auf das Bild klicken!
- Details
 Burg Alt-Windeck Google Maps
Burg Alt-Windeck Google Maps
Burgen allgemein
Kaum ein anderes Gebäude fasziniert uns Menschen so sehr wie die Gebäude aus fernen Ritterzeiten. Burgen in der Art wie Alt-Windeck gibt es seit der Mitte des 11. Jahrhunderts, einst als Wohnsitz hoher Herren erstellt, sollte doch so vor dem einfachen Bauern im Tal die hohe Stellung hervorgehoben werden. Dass Burgen in der Regel auf den Höhen der jeweiligen Gegend erbaut wurde, liegt natürlich auch an ihrer Aufgabe das Land und Volk zu überwachen und mögliche angreifende Truppen frühzeitig zu erkennen. Und das geschah auch bei Burg Windeck recht häufig, waren doch die Herren von Windeck als überaus streitbare Familie bekannt.
Die Burg Alt-Windeck
Burg Windeck ist eine Spornburg, sie liegt wie die meisten Burgen in Deutschland auf einem Bergvorsprung unterhalb des Berggipfels, aber dennoch steil über dem Tal. Das ist nicht nur topografisch die günstigste Lage für den Bau der Burg, eine Spornburg den Vorteil, dass der Burgbrunnen nicht so tief gegraben werden muss, wie es der Brunnen bei einer Gipfelburg erfordert.

In Baden-Württemberg im Landkreis Rastatt. liegt sie hoch über dem Bühler Stadtteil Kappelwindeck. Die Burg auch Burg Alt-Windeck genannt wurde 1200 von den Herren von Windeck errichtet. Von der 376m üNN gelegenen Burg aus gibt es bei schöner Fernsicht einen wunderbaren Blick nach Bühl, in die Vogesen, ins Rheintal und die Ortenau.
Mit zur Burganlage gehört heute ein Hotel, es wurde auf die ursprünglichen Gebäudeteile der Vorburg erbaut. Für Hotelgäste und Besucher gibt es ein Panorama-Restaurant, Cafe und Vesperstube, eine große Terrasse mit herrlichem Ausblick lädt zum Verweilen und Kaffee trinken ein. Das Hotel besitzt im Landhausstil eingerichtete Zimmer.
Die Burganlage und die Burg kann besichtigt werden, sie ist für Erwachsene und Kinder ein großes Erlebnis. Besonders der Besuch des Bergfried mit seiner Wehrplatte ist zu empfehlen, die grandiose Aussicht auf das Umland hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Auf dem Außengelände neben der Burganlage beginnt ein Erlebnispfad der in den angrenzenden Wald führt. Für Kinder gibt es neben der Burgruine einen großen Abenteuerspielplatz.
Öffnungszeiten
Von März bis Oktober ist eine Besichtigung der Burgruine Alt-Windeck täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit möglich.
Von November bis Februar ist eine Besichtigung nur an Samstagen, Sonn- und Feiertagen möglich, bei Schnee und Glatteis ist die Ruine verschlossen.
Anfahrt:
A5 Abfahrt Bühl, weiter bis Bühl, durch Bühl durchfahren und am Krankenhaus links abbiegen, weiter Richtung Kappelwindeck, ab dort ist die Burg ausgeschildert.
Parkplätze:
Kostenlose Parkplätze unterhalb der Burg
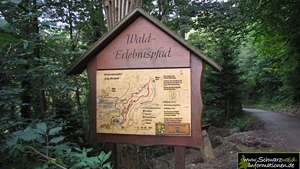 Wanderwege
Wanderwege
Burg Windeck Rundweg:
Die Wanderung führt vom Bahnhof Bühl über den Ortenauer Weinpfad zur Burgruine Alt-Windeck und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt.
Walderlebnispfad Burg Windeck
Die Wanderung beginnt bei der Burg Windeck.
Die Architektur
Die Burganlage besitzt eine ovale Form und wird durch ein meterdickes sehr hohes Rundbogenportal betreten, es trägt das Wappen der Ebersteiner. Der erst schmale Burgweg verbreitert sich in den unteren Burghof, rechts an der Stelle des heutigen Hotels standen früher Wirtschaftsgebäude. Eine steile Steintreppe führt in die Vorburg, den inneren oberen Burghof. Hier befindet sich die innere Burganlage, die Kernburg.. Die Burganlage wurde von mehreren Familien gleichzeitig genutzt und bestand aus einer vorderen und einer hinteren Burg, mit einem viereckigem Burgfried und einem Palas, beide Palasbauten sind weitgehend zerstört es sind aber noch beeindruckende Mauerreste zu sehen.
Die Burganlage wurde von mehreren Familien gleichzeitig genutzt und bestand aus einer vorderen und einer hinteren Burg, mit einem viereckigem Burgfried und einem Palas, beide Palasbauten sind weitgehend zerstört es sind aber noch beeindruckende Mauerreste zu sehen.
Der östliche Bergfried (Wehrturm) mit einer Mauerdicke von 2,5 bis 3 Meter ist 27,6 Meter hoch und fast 10 Meter im Quadrat. Er besitzt ein Tonnengewölbe, der Eingang ist im 4. Geschoss auf einer Höhe von 15,5 Metern, darunter gab es einen 6,5 Meter hohen Zwinger. Der Bergfried kann von Besuchern bestiegen werden, oben gibt es eine Wehrplatte mit ca. 1,5 Meter hohen Zinnen. Die Wehrplatte diente damals und heute der Aussicht auf das Umland. Aber Achtung die steile Holztreppe ist für sehr kleine Füße ausgelegt.
Der westliche Bergfried ist etwa 24 Meter hoch und besitzt eine Seitenlänge von knapp 9 Metern. Er besitzt eine Mauerdicke von über 2,5 Meter, der Eingang liegt auf 12 Meter Höhe. Wer genau hinschaut, wird feststellen, dass die Wände dieses Bergfrieds feiner und sauberer gearbeitet wurden, man vermutet diesen Bergfried auch als den Älteren.
Der Östliche Palas (Wohngebäude) besitzt 5 Geschosse, einen romanischen Fensterdurchbruch mit Sitznische. einen Zugang im 3. Geschos, Wohn- und Rittersaal mit 2 romanischen Fenstergruppen im 4. Geschoss.
Der Westliche Palas besitzt 4 Geschosse, ein romanisches Fenster im 3 Geschoß.
Im inneren Burghof gab es einen Brunnen, ein wichtiger Teil einer Burg, der durchaus einer der zeitlich und finanziell aufwendigste Teil einer Ritterburg sein kann.  Die Geschichte der Burg Alt-Windeck
Die Geschichte der Burg Alt-Windeck
Die Burg wurde um 1200 erbaut und ertrug aufgrund ihrer streitbaren Herren so manche Belagerung, Streit gab es unter anderem mit der Stadt Straßburg, den Grafen von Württemberg im Verbund mit den Martinsvögeln, die Burg wurde mehrfach belagert, eingenommen und zerstört wurde sie aber nie.
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wird die Burg durch einen Großbrand heimgesucht der Ställe und Wohngebäude vernichtet, Reinhard von Windeck lässt die zerstörten Gebäude wieder errichten
Bewohnt wird die Burganlage Alt-Windeck noch bis in das 16. Jahrhundert, dann verlassen die Nachkommen der Herren von Windeck ihre Burg und ziehen in den Schlosshof in Bühl, heutiger Standort des Hotel Badischer Hof.
Nachdem die Burg nie eingenommen und geplündert wurde beginnt nach dem Auszug der Windecker die Plünderung der Burg (erstmals wird die Burg 1561 als in Trümmern liegend bezeichnet), so werden die Wohngebäude zu großen Teilen abgetragen und das damals wertvolle Baumaterial für andere Bühler Gebäude, zum Beispiel die Kappelwindecker Kirche verwendet.
Die Geschichte der Herren von Windeck
 Die Herren von Windeck werden 1212 erstmals als als eine der 16 Ritterfamilien in der Ortenau erwähnt. Sie bauen um 1200 die Burganlage und nennen sich nach ihrer Stammburg. Der Name so sagt es die volkstümliche Überlieferung entsteht durch den "frischen Wind" der bei der Burg den Burgbewohnern um die Nase wehte.
Die Herren von Windeck werden 1212 erstmals als als eine der 16 Ritterfamilien in der Ortenau erwähnt. Sie bauen um 1200 die Burganlage und nennen sich nach ihrer Stammburg. Der Name so sagt es die volkstümliche Überlieferung entsteht durch den "frischen Wind" der bei der Burg den Burgbewohnern um die Nase wehte.
Die Herren von Windeck waren Lehensleute der Grafen von Eberstein, später der Bischöfe von Straßburg, der Markgrafen von Baden, der Geroldsecker, der Lichtenberger, des Kloster Schwarzach und des Reiches.
Die Herren von Windeck besaßen zahlreiche Lehen, waren Schutz- und Gerichtsherr über das Kloster Schwarzach was lange für Macht und Wohlstand sorgte. In der Geschichte des Kloster Schwarzach kommt das Rittergeschlecht der Herren von Windeck aber nicht gut weg, so soll es dort recht übel gehaust haben, wohl auch um die nötigen finanziellen Mittel für ihre Burg und Streitereinen zu erhalten. Erst Kaiser Rudolf von Habsburg soll dem Auftritt der Herren von Windeck ein Ende gemacht haben.
Die Sippe der Herren von Windeck hatte sich im Laufe der Jahre stark vergrößert, zahlreiche Familienstreitigkeiten führten zu einer Spaltung der Familie und Bau der Burg Neu-Windeck in der Nähe von Lauf. Ein verheerender Brand um 1370 zerstört das wertvolle Archiv, damals einziger Beweis zahlreicher Rechtsansprüche werden vernichtet. Eine Hochzeit beider Geschlechter-Familien führte 1466 wieder zur Wiedervereinigung. Anna, einziger Nachfahre des Burkhard von (Alt) Windeck heiratet Ritter Berthold IV von Neu-Windeck, so kommt die Burg 1466 an die Familie ihres Ehemanns.
Im Jahr 1592 stirbt mit Jakob von Windeck der letzte männliche Nachkomme des einst so mächtigen und streitbaren Geschlechts.
Jakob von Windeck vererbte die Güter seinen beiden Schwestern, die Ältere bekam das Haus in Bühl und Neu-Windeck, die Nachkommen verkauften die Güter später an Baden. Die jüngere Schwester Ursula von Windeck erbte Alt-Windeck und brachte es in die Ehe mit Friedrich von Fleckenstein, einem elsässischen Adelsgeschlecht ein. Wie damals üblich kam das Gut nach Aussterben des letzten männlichen Familienmitglied 1720 an die Markgrafen von Baden und später an den badischen Staat.
Informationen zum Urheberecht
Die in diesem Artikel eingestellten Bilder dürfen unverändert und unter Angabe der Quelle kopiert und zum Zweck der öffentlichen Berichterstattung in allen Medien weiterverarbeitet werden.
Für eine größere Version auf das Bild klicken!
- Details
 Schloss Neuenbürg Google Maps
Schloss Neuenbürg Google Maps
Das Schloss Neuenbürg im Enzkreis in Baden-Württemberg liegt hoch über der Enz und Stadt Neuenbürg, etwa zwölf Kilometer südwestlich von Pforzheim. Schloss Neuenbürg ist seit 2001 ein Zweigmuseum des Badischen Landesmuseums Karlsruhe.
Heute wird im Museum Schloss Neuenbürg interessierten Besuchern die Geschichte von Schloss, Stadt und Region Nordschwarzwald vermittelt. So gibt es in einem „begehbaren Theater“ das Schwarzwald-Märchen „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff. Ein Besuch der „Waldlichtung“ gibt Informationen zur Geschichte der Region. Wechselausstellungen, Konzerte, Kinderprogramme und Märkte wie der Mittelalter Markt ergänzen das jährliche Veranstaltungsprogramm. Ein Restaurant und verschiedene Veranstaltungsräume runden das Angebot im Schloss ab.
Informationen zu aktuellen Veranstaltungen http://www.schloss-neuenburg.de/Termine.html
Geschichte und ArchitekturEs ist durch Funde belegt, dass bereits die Kelten vor über 2000 Jahren den Schlossberg besiedelten. Nachweise über die "jüngere" Geschichte Schloss Neuenbürg gibt es erst wieder um das Jahr 1000. Verschiedene Grafengeschlechter, darunter die Pfalzgrafen von Tübingen, die Grafen von Calw-Vaihingen, die Grafen von Eberstein, die Markgrafen von Baden und die Grafen von Württemberg bestimmen die Geschicke und Geschichte der malerisch gelegenen alten Burg Neuenbürg.
Das Schloss (heutige hintere Burgruine) wurde vermutlich von den Grafen von Vaihingen im 11. Jahrhundert gegründet. Die Grafen von Württemberg erwarben die Burg um das Jahr 1320 und errichteten hier einen Amtssitz für die Stadt, die ihnen bereits gehörte, und umliegenden Dörfer. Es folgte 1572 ein Umbau der hinteren Burg zu einem Fruchtkasten (hier Getreidespeicher und Weinlager).
Während des Dreißigjährigen Krieges 1634 wird das Schloss geplündert, 1638 brennt der Nordflügel durch die Unvorsichtigkeit eines bayrischen Fähnrichs ab.
Schloss Neuenbürg besteht aus der alten „Hinteren Burg“, von der nur noch Burgreste mit bis zu 3 Metern dicken Mauern als Ruine geblieben sind und das von Herzog Christoph von Württemberg um 1650 jetzige neue Schloss, das unter Einbeziehung älterer Gebäudeteile erbaut wurde.
Ende des 17. Jahrhunderts wird das hintere baufällige Schloss verkauft und die Mauersteine für den Wiederaufbau der 1783 bei einem Großbrand zerstörten Stadt Neuenbürg verwendet.
Trotz mehrerer Versuche wurde aus Neuenbürg niemals herzogliche Residenz, ließen sich die beehrten Fürsten Herzog Magnus (1594-1622) und Herzog Ulrich (1617-1671) nicht in die Schwarzwaldprovinz locken. Schloss Neuenbürg war immer nur Sitz von Behörden und Ämtern und wurde von herzoglichen Beamten bewohnt. Bis 2004 war das Staatliche Forstamt im Schloss Neuenbürg untergebracht. Ab 1940 beherbergten die Schlossräume Wohnungen und ein Maleratelier.
Seit 2001 ist im Schloss Neuenbürg ein Zweigmuseum des Badischen Landesmuseums eingerichtet.
Schlossgarten Schloss Neuenbürg
Der Schlossgarten entstand um das Jahr 1620 durch Einebnung des Waldstücks zwischen Alter Burgruine und neuem Schloss. Der Garten wurde mit Mauern umgeben und im Stil der Renaissance als Lustgarten angelegt. Ab dem 18. Jahrhundert wird der Schlossgarten als privater Garten der Forstmeister genutzt. Seit 1975 ist der Garten im Schloss Neuenbürg der Öffentlichkeit als Parkanlage zugänglich, wegen der Obstbäume wird der Park bei Neuenbürger auch als Kirschgarten bezeichnet.
Heute finden im Schlossgarten Feste und Veranstaltungen statt, in der Mittelalter-Welt Spectaculum werden Besucher von Gauklern, Axtwerfern, von Märchenerzählern, Schwertkämpfern, Stelzenläufern und Feuerspeiern unterhalten. Alte fast vergessene Handwerksberufe wie Seifensieder, Schmied oder Korbflechter zeigen ihr Handwerk und bieten Lederwaren und Schmuck an kaufwillige Besucher. Ein Spektakel, das man einfach erleben muss.
Alter Friedhof Neuenbürg
Ein Fußweg aus Kopfsteinpflaster führt vom Schloss zum Marktplatz der Stadt, auf dem Sträßchen findet sich eine kleine Steintreppe die auf das Friedhofsgelände der Ruine führt.Der Friedhof unterhalb der Burg war vom Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhundert städtisches Gräberfeld für Neuenbürg und Waldrennach. Sein heutiges Aussehen und Charakter erhielt der in die Schräge des Bergs gebaute Friedhof durch ständige Erweiterungen und Terrassierungen, die heute zu sehende Stützmauer ist aus der Zeit um 1824.
Sehenswerte Grabsteine und Denkmäler aus vier Jahrhunderten mit interessanten Inschriften halten Besucher zum Schauen und Verweilen an. Im Inneren der kleinen Kirche finden sich weitere Grabsteine und Denkmäler. Neben einer herrlichen Aussicht auf Neuenbürg finden sich zahlreiche Bänke zum Ausruhen und für Westweg-Wanderer interessant, einen Brunnen mit moderner Wasserleitung, wir vermuten mal, dass es Trinkwasser ist, an der Wand der Kirche steht "In treuer Erinnerung an seine Heimat stiftete diese Wasserleitung Carl Kraft in Nizza anno 1898".
Wie zum Schloss Neuenbürg kommen
Wanderer der Westweg Etappe 1 Pforzheim-Dobel kommen direkt an Schloss Neuenbürg vorbei.
Wer nur das Schloss besichtigen möchte, parkt im Ort in der Nähe des Markplatzes. Hinter der evangelischen Kirche führt der Weg zum Schloss. Der steile Fußweg aus Kopfsteinpflaster führt zuerst zum Friedhof und dann zum Neuen Schloss. Der Weg ist sehr gut ausgeschildert.
Informationen zum Urheberecht
Die in diesem Artikel eingestellten Bilder dürfen unverändert und unter Angabe der Quelle kopiert und zum Zweck der öffentlichen Berichterstattung in allen Medien weiterverarbeitet werden. Für eine größere Version auf das Bild klicken!
































































































